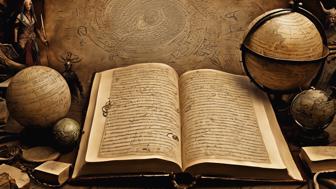Kunstsprachen faszinieren sowohl Linguisten als auch Kreative und bieten ein spannendes Themenfeld. Der renommierte Linguist John McWhorter hat in seinen TED-Ed-Vorträgen die unterschiedlichen Aspekte und Funktionen dieser konstruierten Sprachen beleuchtet. Kunstsprachen ermöglichen einen strukturierten Zugang zu Grammatik und Wortschatz, häufig inspiriert durch natürliche Sprachen. In ihrem Werk ‚Sprache in der Kunstkommunikation‘ (Waxmann, 2017, Münster, New York) gehen Anna Nüschen und Ronja Stamp auf die bedeutende Rolle von Kunstsprachen in der Bildenden Kunst ein. Sie betonen die Relevanz geeigneter Lehr- und Lernmaterialien im Deutsch- und Kunstunterricht, um die historische Entwicklung und die verschiedenen Schreibweisen dieser Sprachen nachvollziehbar zu machen. Somit erweist sich die Kunstsprache als wertvolles Instrument für Sprachgemeinschaften und fördert auf vielfältige Weise die kreative Ausdruckskraft.
Vielfalt der konstruierten Sprachen
Kunstsprachen sind faszinierende, konstruiert und bieten eine reiche Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten. Beispiele wie Dothraki und Hochvalyrisch aus der Welt von Essos zeigen, wie kunstvolle Sprachen in Medien und Literatur lebendig werden. Dabei verstehen viele Schülerinnen und Schüler, dass diese Sprachen mehr sind als nur abstrakte Konstruktionen: Sie sind Teil einer Kunstkommunikation, die sprachlich und kulturell ansprechend ist.
Die synthetische Sprache Volapük oder die extrem präzise Sprache Ithkuil ziehen Sprachbegeisterte in ihren Bann. Esperanto als die bekannteste Plansprache hat das Ziel der internationalen Verständigung gefördert und Clemens J. Setz nutzt in seiner Poesie die Eigenheiten kunstsprachlicher Strukturen. Die Materialsammlung dieser Kunstwerke ist breit gefächert und eröffnet neue Perspektiven im Lehr-Lernkontext, in dem Prashad oder ähnliche Ansätze als Teil der Bildenden Kunst behandelt werden können.
Zweck und Formen von Plansprachen
Der Zweck von Plansprachen ist oft die Förderung einer internationalen Kommunikation, wobei Kunstsprachen wie Esperanto, entstanden durch Zamenhof, prominente Beispiele darstellen. Diese Sprachen verfolgen eine demokratische Auffassung und dienen als neutraler Boden für die Sprecher*innengemeinschaft. Zu den Motivationen hinter ihrer Entwicklung zählen der Wunsch nach Entbabelung und die Reduktion von sprachlichen Barrieren, ähnlich dem biblischen Turmbau zu Babel. Neben Esperanto gab es weitere konstruierte Sprachen, wie Volapük und Solresol, die jeweils eigene Ansätze bieten. Logische Sprachen und philosophische Sprachen entstehen oft aus dem Bedürfnis nach klarer Ausdrucksweise, während Geheimsprachen spezifische kulturelle oder soziale Gemeinschaften ansprechen. Diese Vielfalt demonstriert die unterschiedlichen Ansätze und Ziele, die mit der Schaffung von Kunstsprachen einhergehen.
Kunstsprache in Literatur und Kommunikation
Kunstsprache findet Anwendung in verschiedenen Erscheinungsformen der Literatur und Kommunikation. In der Bildenden Kunst wird durch konstruierte Sprachen eine besondere Ästhetik geschaffen, die die Grenzen der traditionellen Grammatik überschreitet und neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet. Diese künstlichen Sprachen fungieren nicht nur als linguistisches Medium, sondern auch als Konzept für die Sprachanalyse und die Entwicklung pragmatischer Forschungsbereiche innerhalb der Linguistik. Im Kontext von Lehrmaterialien und Lernmaterialien, insbesondere im Deutsch- und Kunstunterricht, können Kunstcommunicatio als innovative Werkzeuge zur Förderung kreativen Denkens eingesetzt werden. Hierbei spielen Terminologie und Philosophie eine entscheidende Rolle, um die Funktionen von Kunstsprache zu verstehen und die künstlerische Intention zu kommunizieren. Insgesamt trägt die Auseinandersetzung mit Kunstsprache zur Bereicherung der Kommunikationskultur und zur Erweiterung des Wissenstands in der Wissenschaft bei.